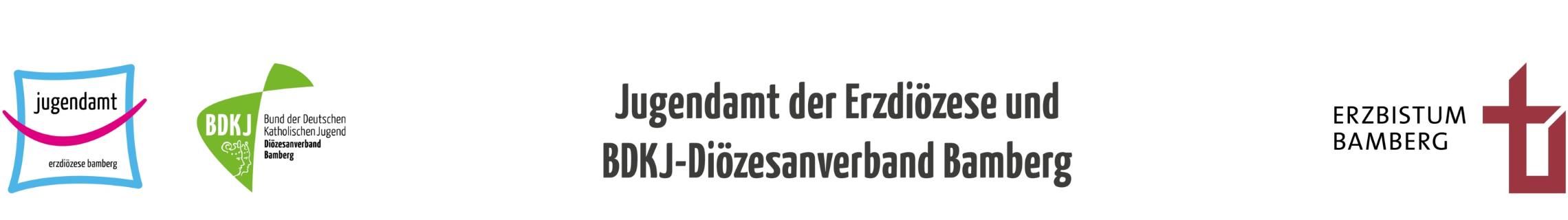Laufen als Gebet

Schwester Magdalena berichtet von ihrer Pilgerreise auf dem Camino Ignaciano

Beim Start liegt nur eine Bergkette zwischen Loyola und dem Atlantik, das Meer ist am Horizont fast noch zu erahnen. In den ersten sechs Tagen muss ich fast jeden Tag eine Bergkette überwinden und mich vom Meer entfernen. Berge, die im Vergleich mit den Alpen erst einmal niedrig wirken - die höchsten Gipfel sind etwas höher als 1.500 Meter über dem Meer – aber doch den höher gelegenen Landschaften der Alpen ähneln: Während die Baumgrenze in den Alpen bei knapp 2000 Meter liegt, liegt sie hier bei 1.000 Metern, darüber kommen erst Gestrüpp, dann Gräser und Felsen. Eine Hochgebirgslandschaft. Im Gehen durchaus anstrengend, aber abwechslungsreich und schön, manchmal auch abenteuerlich.
Zu Fuß gehend verändern sich Raum und Zeit: Ein Tag ist lang, äußerlich ist wenig los, im Wesentlichen besteht er im Gehen – und doch bin ich am Abend oft erstaunt, wie gefüllt der Tag war. Jede Begegnung, jede äußere und innere Regung wird spürbar und bekommt Gewicht. Wenn am Morgen schon das Etappenziel sichtbar ist, oder am Mittag noch der Weg des Vortages, werden 20 bis 30 Kilometer klein und groß zugleich.
Und Ignatius? Auf seinem Maultier dürfte er kaum schneller als ich vorangekommen sein. Wie er diesen Weg erlebt, dazu schreibt er in seinem Pilgerbericht nicht viel. Über das, was ihn auf dem Weg beschäftigt hat, schweigt er. Und so bleibt die Frage, was ihm beim Abschied von seiner Heimat durch Kopf und Herz gegangen sein mag. War sein „Abschied für immer“ und sein Weg in eine Welt, die er noch nicht einmal aus dem Fernsehen oder Internet kannte, wirklich nur beflügelt? Und wenn er voller Ideale, Träume und Hoffnungen aufgebrochen ist – was ist mit diesen auf dem Weg geschehen?
Auf den Hochebenen weiden Rinder und Schafe, aber auch Pferde, Esel und Schweine. In den kleinen baskischen Bergdörfern fällt jeder Fremde sofort auf. In vielen Dörfern begrüßt man mich herzlich, nimmt mich offen auf. Manche Pause dauert so zwei, drei Stunden – von einem Gespräch ins nächste, ich werde eingeladen. Dann kommt nach dem letzten Pass der Abstieg in die Region La Rioja. Die erste Begegnung mit dem Ebro, dessen weitem Tal der Weg dann folgt. Die Hänge sind voller berühmter Weinstöcke. Zwischen Navarrete und Logroño ist auf 13 Kilometern der Camino Ignaciano mit dem Hauptweg des Jakobsweges in Spanien identisch. Mir kommen unentwegt Jakobspilger entgegen. Manche rufen mir freundlich zu: Achtung, falsche Richtung! Während auf dem Jakobsweg viele Pilger unterwegs sind, ist der Camino Ignaciano ein einsamer Weg: Zwei spanische und ein französischer Pilger sind mir in zehn Tagen begegnet. Aber das bietet die Chance, mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu kommen und gibt mir reichlich Gelegenheit, mein Spanisch zu üben.
Der Wein wird abgelöst vom Duft reifer Pfirsiche. Fast unmerklich wird es langsam trockener und heißer. Olivenbäume und Mandelbäume stehen auf Äckern, die manchmal fast nur aus Steinen bestehen. Und immer mehr dürres Gestrüpp, Disteln, trockenes Land. Über unzählige Kilometer verläuft der Camino jetzt auf dem Schotterweg neben einer Eisenbahnstrecke, oft schnurgerade. Der „Camino de hierro“, der „eiserne Weg“, wie ihn der Pilgerführer nennt. Es gibt wenig Bäume, kaum Orientierungspunkte, die Sonne brennt unbarmherzig. Für mich der härteste Teil des Weges, der Denken und Fühlen leert. In manchen Momenten frage ich mich, ob ich den Weg auch gewagt hätte, wenn ich gewusst hätte, was mich erwartet. Ich bin mir nicht sicher. Aber Schritt für Schritt und Kilometer für Kilometer laufe ich hinein in die Erfahrung einer tiefen inneren Stille und großen Freiheit, in der an die Stelle des Brauchens die Dankbarkeit tritt und am Ende nur der Weg auf Gott hin zählt. Die sieben Kilogramm Gepäck in meinem Rucksack, zwei Liter Wasser, ein paar Kekse, Nüsse und Obst sind dafür genug.
Dann wird es langsam wieder grüner, in der Nähe des Ebro ist das Land fruchtbar. Und es weht ein heftiger Wind, der bis in die Großstadt Zaragoza reicht. Hinter der Stadt folgt der Abschied vom Ebro – und der Aufstieg in die Monegros, die schwarzen Berge im Herzen Aragóns. Eine Hügel- und Hochebenenlandschaft mit extremer Trockenheit. Die kleinen Wacholderbüsche, die hier noch wachsen, lassen die Landschaft aus der Ferne dunkel erscheinen. Kein Wasser, kein Schatten, eine Endlosigkeit, die die Orientierung und das Gefühl für Entfernungen verlieren lässt. Und die Gewissheit, dass einem hier so schnell kein Mensch begegnen wird. Nach einem Jahr Camino-Pause geht es im Sommer 2019 mit den drei gefürchteten Etappen durch die Monegros weiter. Sengende Sonne, Schatten nur alle paar Stunden hinter einer Ruine, kein Wasser, Siedlungen im Abstand von Tagesreisen. Und doch genieße ich diese Etappen: Gerade der Hektik des Alltags entkommen, trotz Streik und technischen Defekten schließlich in Spanien gelandet, den Rummel des Hauptbahnhofs der Millionenstadt Barcelona mit dem undurchschaubaren, komplexen System verschiedener Eisenbahn-Unternehmen bestanden, habe ich nach den ersten Schritten hinein in die dürre Stille der Monegros aufgeatmet. Hier wird der Mensch mit all seinem Tun klein.
Wirklich anstrengend wird es mit dem Abstieg ins Tal zwischen den beiden Städten Fraga und Lérida. Ja, es war heiß oben in den Monegros. Und doch wehte immer ein leichter Wind, nachts und morgens war es erfrischend kühl. Unten im Tal dagegen bin ich schon morgens beim Aufbruch nassgeschwitzt. Ignatius folgte hier im Tal der Hauptverkehrsstraße seiner Zeit, dem Camino Real, der bis heute eine Verkehrsader geblieben ist – inzwischen gibt es eine Autobahn und eine Nationalstraße. Für Pilger bedeutet dies: Viele Kilometer Asphalt entlang der Schnellstraßen. Umso überraschender sind daher die letzten zehn malerischen Kilometer an den Rand der Großstadt Lérida: seit dem Mittelalter ein großes Obstanbaugebiet.
Obstanbau begleitet mich auf den folgenden Etappen – und damit die Begegnung mit unzähligen afrikanischen Saisonarbeitern, die auf den Plantagen Pfirsiche, Äpfel oder Nektarinen pflücken. Zwölf bis dreizehn Stunden täglich, erzählt mir ein Algerier - bei 35 bis 40 Grad Hitze. Dafür gibt es keine fünf Euro Stundenlohn. Auch wenn wenig übrig bleibe angesichts der Lebenshaltungskosten in Europa, verdiene er etwas mehr als zu Hause, sagt er, als ich frage, warum er das macht. Die schwarzen Gesichter der Obstpflücker, viele kommen aus Senegal, sind mir sehr präsent, als ich in Verdú in der Pilgerherberge im Geburtshaus des Heiligen Petrus Claver übernachte – des „Sklaven der afrikanischen Sklaven“ im Cartagena des 16. Jahrhunderts. Die alten Gestalten des Pilgerweges, dem ich folgte, sind noch immer aktuell.
Nach einigen Tagen durch sehr trockenes und einsames Land heißt es im Pilgerführer beim Aufstieg auf eine Hügelkette: „Wir durchqueren eine Gegend mit vielen Bäumen“. An dieser Stelle grinse ich – ja, es gibt mehr Bäume als zuvor, aber gleich Wald? Doch jenseits der Hügelkette komme ich tatsächlich im mit Pinienwäldern bewaldeten Hügelland Kataloniens an, das mich hinaufführt auf den Montserrat, jenen Berg, der in seinem Kloster mitten in den Felsen, einen der wichtigsten Wallfahrtsorte Spaniens birgt – auch schon zur Zeit des Ignatius. Die Anzahl der Hotels und Vergnügungsstätten an diesem Ort mag damals geringer gewesen sein, aber viel ruhiger war es wohl nicht. Vom Montserrat aus geht es auf dem alten Pilgerweg, der damals Montserrat und Manresa verband, ans Ziel des Camino Ignaciano: Zur Cueva des Ignatius in Manresa. Wie Ignatius werde ich dort herzlich eufgenommen und versorgt, habe Zeit für Erholung und Reflexion.
Und doch: Auch wenn der Camino Ignaciano hier eigentlich endet, ist Manresa nicht das Ziel. Es war nicht das Ziel des Ignatius, und es ist auch nicht mein Ziel. Es geht weiter nach Barcelona. Den beeindruckenden Weg durch den Nationalpark Sant Llorenç del Munt hat Ignatius wohl nicht gewählt, aber vielleicht den alten Pilgerweg der Mönche des Klosters Sant Llorenç zum Kloster Sant Cugat. Hinter dem Kloster steige nach Barcelona hinab. Dort suche ich nicht wie Ignatius das Schiff nach Jerusalem, sondern beende meinen Pilgerweg in der Basilika Santa Maria del Mar, in der Ignatius später an der stets gleichen Stelle saß und bettelte. Santa Maria del Mar war für mich so der symbolische Ort, an dem der äußere Pilgerweg hinüberführt in den Pilgerweg des Alltags, der Ort, an dem ich Abschied genommen habe vom Weg des Ignatius.
Unterwegs in seinen Spuren ist Ignatius für mich lebendig geworden als ein Mann, der zwar seinen ganz persönlichen Weg ging, aber doch nicht losgelöst von Kontext und Beziehungen: Er folgte dem Camino Real, der Hauptverkehrsader seiner Zeit, auf der ihm unzählige Menschen begegnet sein dürften. Wie viele andere Pilger suchte er den Montserrat auf. Und sicher nicht zufällig wählte er Manresa: Jene Stadt, die damals Spiritualität atmete und voller Eremiten und religiös Suchender war.
Ignatius ließ sich dort aufnehmen, versorgen und beschenken – eine Erfahrung, die ganz zentral auch zu meinem Weg gehört. Es gab keine Nacht, in der ich kein Dach über dem Kopf hatte; ich habe keinen Hunger gelitten – und immer wieder bin ich es gewesen, die beschenkt wurde: mit einem Apfel, landestypischen Keksen, einer Karte, einem Kreuz. Der Weg ist für mich verbunden mit den Gesichtern von Menschen, die mich aufgenommen haben. Mit den Gesichtern der Menschen, die mich angesprochen, mir den Weg gewiesen, ein paar Gedanken mit mir ausgetauscht haben. Und mit den Gesichtern jener Menschen, die mich von Deutschland aus in Gedanken und im Gebet begleitet haben. So bin auch ich meinen persönlichen Weg gegangen – aber nicht allein, sondern getragen von Vielen.